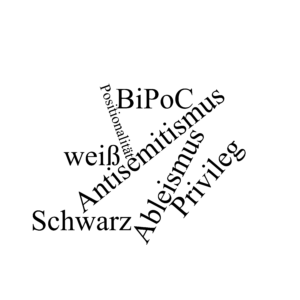
A
Der Begriff ,,Ableismus‘‘ setzt sich zusammen aus dem englischen Wort ,,able‘‘ (be able : deutsch fähig sein) und ,,ismus‘‘. Die Endung „ismus“ deutet auf ein geschlossenes Gedankensystem hin. Ableismus ist die alltägliche Reduzierung eines Menschen auf seine körperliche oder geistige Beeinträchtigung. Und damit geht die Auf- oder Abwertung einher. Auch eine ,,nicht Sichtbarkeit‘‘ dieser Menschen in der Gesellschaft geht damit einher.
Der Begriff Adult kommt aus dem Englischen und bedeutet „erwachsen“. Diese Art der Diskriminierung beschreibt die Machtungleichheit zwischen jungen Menschen und Erwachsenen. Damit ist die Diskriminierung junger Menschen allein aufgrund ihres Alters gemeint. Erwachsene ignorieren oft die Ideen, Meinungen und Realitäten der jungen Menschen oder nehmen sie nicht wahr. Mit dem Machtgefälle geht eine Abwertung und Unterdrückung einher.
Die Altersdiskriminierung (age: das Alter) bezeichnet eine soziale und ökonomische Diskriminierung von Menschen oder Gruppen aufgrund ihres Lebensalters. Den Betroffenen (meist älteren Menschen), wird unmöglich gemacht in angemessener Weise am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es kann auch eine Begünstigung bestimmter Altersgruppen damit gemeint sein.
Allyship ist eine aktive, konsequente und anstrengende Praxis des Verlernens und Neubewertens, bei der eine Person in einer privilegierten und machtvollen Position versucht, in Solidarität mit einer Randgruppe zu handeln. Allyship ist keine Identität – es ist ein lebenslanger Prozess des Aufbaus von Beziehungen auf der Grundlage von Vertrauen, Beständigkeit und Verantwortlichkeit mit marginalisierten Einzelpersonen und/oder Gruppen von Menschen. Allyship ist keine Selbstdefinition – die Arbeit und die Bemühungen von Verbündeten müssen von den Menschen, mit denen sie sich verbünden wollen, anerkannt werden.
(Quelle: Theantioppresionnetwork. Aus dem Englischen von https://theantioppressionnetwork.com/allyship/, 22.04.2022)
ist eine tief verwurzelte, ideologisch geprägte Form des Vorurteils und der Diskriminierung gegen jüdische Menschen, die sich in Hass, Feindseligkeit, Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Juden sowie ihrer Religion, Kultur, Gemeinschaften und Institutionen ausdrückt. Antisemitismus manifestiert sich in verschiedenen Formen, einschließlich verbaler Angriffe, körperlicher Gewalt, Vandalismus gegen jüdische Einrichtungen und systematischer Verfolgung. Antisemitismus basiert nicht nur auf falschen Wahrnehmungen oder Stereotypen, sondern ist oft durch eine ablehnende Haltung charakterisiert, die historische, kulturelle und soziale Vorurteile nutzt, um Juden zu diskriminieren oder auszugrenzen.
B
ist die Abkürzung von Black, Indigenous, People of Color und bedeutet auf Deutsch Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color wird nicht übersetzt. All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen. Das bedeutet, sie sind aus einem Widerstand entstanden und stehen bis heute für die Kämpfe gegen diese Unterdrückungen und für mehr Gleichberechtigung.
Quelle: Migrationsrat Berlin e.V.
D
Kolonien des Deutschen Reiches (ehemalig als „Schutzgebiete“ bezeichnet)
o Deutsch-Südwestafrika (heutiges Namibia) wurde 1884 von Kaufmann A. Lüderitz „erworben“, ab 1885
zum Deutschen Kolonialgebiet zugehörig. 1915 von der Südafrikanischen Union besetzt und 1918/9 durch den
Versailler Vertrag offiziell dem Deutschen Reich aberkannt.
o Deutsch-Ostafrika (heutiges Tanzania, Sansibar (bis 1890), Ruanda, Burundi) wurde mit Hilfe der Deutsch-
Ostafrikanischen Gesellschaft 1885 zum „Schutzgebiet“ Preussischer (Brandenburg-Preussen) Kolonialbesitz“:
o Kolonie Gross Friedrichsburg (im heutigen Ghana gelegen) (1683-1717/21) von hier aus handelte die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie
o Insel St. Thomas ab 1685 von Dänemark gepachtet, diente als karibischer Stützpunkt des Deutschen Reiches
o Insel Arguin (vor Mauretanien gelegen)(1685-1721)
o Insel Vieques ( heute zu Puerto Rico gehörig) (1689-1693)
o Ouidah (heutiges Benin) (um 1700)
E
Der Begriff bezeichnet einen Prozess der Stärkung, des Sich-Selbst-Befähigens. Im Kontext von Diskriminierung geht es um das Erkennen und Sichtbarmachen der eigenen Stärken und Ressourcen und darum, sich diese zu Eigen zu machen, für sich selbst zu nutzen und so eine größere Autonomie und Eigenständigkeit zu bekommen, um an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen teilhaben zu können.
Zuschreibung einer homogenisierenden „natürlichen Essenz“ auf einen als anders markierten Kontext. Das können u.a. Individuen, Gruppen, Länder oder auch Wissenssysteme sein. Vielfalt, Geschichte, räumliche Kontexte und die
Dynamik des Seins werden nivelliert und gewaltvoll objektiviert.
Wird die Verschiedenheit zwischen Gruppen von Menschen unter Ausblendung von Gemeinsamkeiten auf „ethnische“ Unterschiede reduziert und werden damit soziale Prozesse erklärt, wird häufig von Ethnisierung gesprochen. Selbstethnisierung ist die Selbstbeschreibung auf Grundlage „ethnischer“ Kategorien und kann der Durchsetzung eigener Interessen oder einer Identitätspolitik dienen. Fremdethnisierung ist ein sozialer Ausschließungsprozess, der Minderheiten schafft, diese negativ bewertet und die Privilegien der Mehrheit sichert.
Quelle: IDA e.V. – Glossar (idaev.de)
Europa konstruiert sich selbst als Zentrum v on Weltgeschichte und der Universalisierung von Werten, Vernunft und Theorie. Von dieser Position aus wird eurozentrisches Wissen produziert und als Maßstab gesellschaftlicher Analysen und politischer Praxis herangezogen, ohne dabei die historische und kulturelle Partialität dieser Perspektive zu erkennen. Dies zeigt sich besonders deutlich im Zusammenhang mit Kolonialismus, wo die
europäische Geschichte und Gesellschaftsentwicklung als Norm verstanden wird, die erfüllt oder von der abgewichen wird.
In dieser Grundeinstellung wird das vermeintlich Fremde, wie z. B. fremde Kulturen, als überaus positiv bewertet. Das Fremde wird zur „Projektionsfläche der eigenen Sehnsüchte“ und alleine unter „exotischen“ Aspekten wahrgenommen und konstruiert. Damit ist Exotisierung eine Strategie, um Gruppen zu hierarchisieren und durch vermeintlich positive Attribute, darunter oftmals mit Bezug auf Naturverbundenheit oder freizügige Körperlichkeit, eine Personengruppe abzuwerten und sie als „unzivilisiert“ erscheinen zu lassen.
G
Die Bezeichnungen „Globaler Süden“ und „Globaler Norden“ verstehen sich nicht als strikt abgegrenzte geographische Gebiete, sondern als Begriffe, die auf einer unterschiedlichen Erfahrung mit Kolonialismus und
Ausbeutung beruhen und die bestehende Hierarchien in der Wissenschaftsproduktion in Frage stellen. Dem Globalen Süden gehören Räume an, die im globalen System eine marginalisierte Position einnehmen. Den Globalen Norden kennzeichnet eine mit Privilegien bedachte räumliche Position. Globaler Süden und Globaler Norden sind
in hierarchischen Abhängigkeitsverhältnissen miteinander verbunden.
I
Islamfeindlichkeit ist eine tief verwurzelte Form von Vorurteil, Diskriminierung und Ablehnung gegenüber Muslimen und dem Islam. Im deutschen Kontext manifestiert sich Islamfeindlichkeit häufig durch stereotype Vorstellungen, Fehlinformationen und Vorurteile, die Muslime in Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftlichen Ängsten und politischen Debatten bringen. Diese Form der Ablehnung zeigt sich in verbalen Angriffen, diffamierenden Äußerungen, Vandalismus gegen Moscheen und islamische Einrichtungen sowie in diskriminierender Behandlung im Alltag, beispielsweise im Arbeitsleben, in Bildungseinrichtungen oder beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Islamfeindlichkeit basiert häufig auf Falschinterpretationen oder Extremismus-Vorurteilen, die kulturelle oder religiöse Unterschiede als Bedrohung für die gesellschaftliche Integration darstellen, und wird durch politische Diskurse, Medienberichterstattung oder gesellschaftliche Spannungen verstärkt. Sie trägt dazu bei, Muslime in Teilen der Gesellschaft auszugrenzen, zu diskriminieren oder zu stereotyper Verurteilung zu verleiten.
Intersektionalität ist ein wissenschaftliches und politisches Konzept, das die komplexe Verwobenheit multipler Identitätskategorien betrachtet, also davon ausgeht, dass jede Person* immer in mehreren sozialen Positionen verortet ist und Diskriminierungserfahrungen daher niemals allein durch eine einzige Herrschaftskategorie erklärt
werden können. Das Zusammenspiel der mit ihnen verbundenen Unterdrückungssysteme wirkt sich in unterschiedlichster Weise auf Privilegien, Diskriminierungen und somit auf das Erleben hegemonial formulierter Kategorien aus, die sich gegenseitig konstituieren. Das Konzept der Intersektionalität wurde von Schwarzen
Frauen*, wie das Combahee River und Kimberlé Crenshaw eingeführt, die die Vorherrschaft weißer, heterosexueller Frauen in der zweiten Welle des Feminismus kritisierten und hervor hoben, dass ihre Lebensrealität bzw. ihr Erleben von Unterdrückung weder allein durch die Analysekategorie Geschlecht, noch durch die Analysekategorie Race beschrieben werden kann.
Quelle: Katrin Singer (2019) Confluencing Worlds. Skizzen zur Kolonialität von Kindheit, Natur und Forschung im Callejón de Huaylas, Peru. (Glossar)
K
ist eine Form der vorurteilsbegründeten Diskriminierung und Ausgrenzung, die auf der sozialen Herkunft, dem sozialen Status oder der sozialen Position von Menschen basiert. Klassismus richtet sich insbesondere gegen Angehörige der am wenigsten privilegierten sozialen Klassen. Voraussetzung für Klassismus ist ein Klassenbewusstsein, das dazu führt, dass Personen stereotypisiert werden, weil sie nicht in bestimmte gesellschaftliche Kategorien oder Normen passen. Durch diese Stereotypisierung und Diskriminierung werden Menschen aufgrund ihrer sozialen Zugehörigkeit systematisch benachteiligt, ausgegrenzt und in ihren sozialen Aufstiegschancen eingeschränkt.
Koloniale Kontinuitäten beziehen sich auf die fortbestehenden Strukturen, Diskurse und Machtverhältnisse, die aus der Kolonialzeit in postkolonialen Gesellschaften weiterwirken. Sie umfassen soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte, in denen koloniale Denk- und Handlungsmuster, Hierarchien und Privilegien weiterhin präsent sind. Diese Kontinuitäten beeinflussen das institutionelle Zusammenleben, soziale Ungleichheiten und den Umgang mit unterschiedlich marginalisierten Gruppen, wodurch die koloniale Vergangenheit oftmals in aktuellen gesellschaftlichen Strukturen fortbesteht.
In einer Stadt wie Hambug hinterlassen koloniale Verbindungen bis heute Spuren, etwa durch die vielfältigen historischen Handelsbeziehungen, Namen von Gebäuden und Straßen oder durch die soziale und kulturelle Vielfalt, die auch auf den kolonialen Austausch zurückzuführen ist. Die strukturellen Auswirkungen dieser kolonialen Geschichte, etwa im Zusammenhang mit postkolonialen Machtverhältnissen, sind in Hamburg deutlich sichtbar.
Kolonialismus als ein weltweites Phänomen entzieht sich einer spezifischen Definition, und vielleicht ist daher auch der oft zitierte Versuch von Jürgen Osterhammel treffend, der in seiner definitorischen Rahmung allgemein bleibt und damit Raum für weitere Interpretationen eröffnet. „Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine
kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen“ Osterhammel 1995: 21). Diese sogenannten „sendungsideo-
logischen Rechtfertigungsdoktrinen“ lassen sich im Sinne von Osterhammel auch in der Infantilisierung und Kolonisierung von Lateinamerika finden.
Die Positionen weiß-Sein und Schwarz-Sein beziehen sich immer aufeinander. Sie sind nicht unabhängig
voneinander denkbar. Deshalb sollte die gesellschaftliche Privilegierung von Menschen, die keine
Rassismuserfahrungen machen, thematisiert werden. Diese Positionierung weißer Menschen, die als Gegenstück zur Ausgrenzung rassistisch diskriminierter Menschen besteht, muss wahrgenommen werden. Das ist eine Basis von Rassismus. Deshalb sollte eine kritische Auseinandersetzung mit dem privilegiertem weiß-Sein und die Bevorzugung weißer Menschen im Kontext von Rassismus behandelt werden.
bezeichnet den Prozess, bei dem soziale, politische oder wirtschaftliche Phänomene, Probleme oder Differenzen durch „kulturelle“ Erklärungen und Zuschreibungen verstanden, interpretiert oder naturalisiert werden. Dabei werden gesellschaftliche Themen vor allem unter dem Blickwinkel von Unterschieden betrachtet und auf „kulturelle“ Stereotype reduziert, wodurch komplexe Zusammenhänge vereinfacht oder verzerrt werden können.
Ein häufig genanntes Beispiel ist die Diskussion um Migration, bei der soziale Herausforderungen wie Integration oder Arbeitsmarktbeteiligung häufig ausschließlich auf sogenannte kulturelle Unterschiede (z.B. „andere Werte“ oder „andere Lebensweisen“) zurückgeführt werden. Dadurch werden mögliche strukturelle oder ökonomische Ursachen ausgeblendet und die Problematik auf „kulturelle“ Differenzen reduziert.
N
ist eine ideologische Haltung oder Bewegung, die die eigene Nation, ihre Kultur, Geschichte und Interessen in den Vordergrund stellt, oft verbunden mit dem Wunsch nach politischer Selbstbestimmung oder Unabhängigkeit. Nationalismus basiert auf dem Gefühl der Zugehörigkeit zur Nation und fördert den Stolz auf nationale Identität, häufig auf Kosten anderer Gruppen oder Nationen. So formt sich die kollektive Identität einer Nation. Die eigene Nation wird so erhöht und andere Nationen abgewertet.
„In der Forschung wird die Konstruktion angeblich homogener Kulturen und Identitäten als Neorassismus bezeichnet. So versuchen neurechte Akteure, dem Rechtsextremismus eine intellektuelle Maske aufzuziehen und alte Ideen in neue Sprüche zu verpacken. Mit dem jüngsten Erfolg rechtsextremer und rechtsradikaler Parteien wurde ihr Theoriekanon zunehmend von relevanten Akteuren übernommen. Es entstand eine vielfache Wechselwirkung zwischen rechten Parteien, Bewegungen und Denkfabriken.“
Quelle: Factsheet_Identitaerer_Neorassismus.pdf (idz-jena.de), 22.04.2022
P
Positionierung bezeichnet den Prozess, bei dem eine Person oder eine Organisation ihre Stellung, Identität oder Meinung in Bezug auf ein bestimmtes Thema oder innerhalb einer sozialen Gruppe festlegt und sichtbar macht. Es geht um die bewusste Abgrenzung und Darstellung der eigenen Position, um bestimmte Werte, Überzeugungen oder Zielgruppen zu vermitteln und dadurch eine klare Einordnung im Bewusstsein anderer zu erreichen.
„Ein Privileg ist ein Recht, ein Vorteil oder eine Sicherheit, die ein Mensch aufgrund einer (zugeschriebenen) Zugehörigkeit zu einer Gruppe bekommt. Gleichzeitig bleibt diese Person aufgrund dieses Privilegs von bestimmten Belastungen und Diskriminierungen verschont. Privilegien beruhen auf historisch gewachsenen, institutionalisierten Systemen – wie beispielsweise Sexismus oder Rassismus.“
Quelle: Quix kollektiv für kritische Bildungsarbeit(2016):Willst du mit mir gehen.
Gender_Sexualitäten_Begehren in der machtkritischen und entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, S.98.
Der Postkolonialismus ist eine wissenschaftliche, kulturelle und politische Strömung, die die Auswirkungen und Nachwirkungen kolonialer Herrschaft auf Gesellschaften, Kulturen und Wissensstrukturen analysiert. Er beschäftigt sich mit den Prozessen der Dekolonisierung, dem Fortbestehen kolonialer Machtverhältnisse, den Diskursen und Identitäten sowie mit den Kontinuitäten kolonialer Denkweisen in postkolonialen Gesellschaften. Ziel ist, koloniale Dominanz zu hinterfragen, koloniale Narrative zu dekonstruieren und soziale, kulturelle sowie politische Emanzipation zu fördern.
Dabei geht es nicht nur um eine Beschreibung der Vergangenheit, sondern um die kritische Analyse der anhaltenden Strukturen, Diskurse und Machtverhältnisse des Kolonialen. Postkoloniale Theoretiker*innen wie Franz Fanon, Edward Said, Stuart Hall, Aníbal Quijano, Walter Mignolo oder Dipesh Chakrabarty haben gezeigt, wie koloniale Narrative, Stereotype und Konstruktionen der „Anderen“ bis heute wirken. Ziel des Postkolonialismus ist es, diese Narrativen zu entlarven, den kolonialen Kern in bestehenden Strukturen zu erkennen und einen Weg zu gesellschaftlicher Emanzipation und Erneuerung zu ermöglichen.
Q
Bezeichnet die Diskriminierung von schwulen und lesbischen Menschen. Dieses wird zum Beispiel durch Ablehnung, Wut, Intoleranz, Unglauben oder körperliche und psychische Gewalt deutlich. So wird das Leben für Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind, in der Gesellschaft schwer. Die hetero-narrative Form der Gesellschaft, die dem zugrunde liegt, wird nicht reflektiert.
R
Ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund bestimmter biologischer Merkmale kategorisiert, beurteilt und abwertet. So gelten diese Menschen als weniger wert. Das klassische, theoretische Konzept war vorherrschend in der Epoche des Kolonialismus. Es wurde damals entwickelt, um die Ausbeutung, Ermordung und Abwertung nicht weißer Menschen zu legitimieren. Auch heutzutage bevorzugt das System Rassismus noch immer weiße Menschen und schadet nicht weißen Menschen erheblich. Rassismus äußert sich in Vorurteilen, Diskriminierung, Ausgrenzung oder Gewalt und trägt zur Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten bei.
Wenn etwas romantisiert wird, wird es nicht realistisch erfasst, sondern häufig mit positiven Attributen versehen. Bei Reisen, insbesondere in den Globalen Süden, wird häufig die Armut von Menschen („arm, aber glücklich“) romantisiert und die Zusammenhänge von Armut und historischen wie aktuellen Machtverhältnisse und ökonomischen Bedingungen bleiben unberücksichtigt.
Quelle: glokal: BroschuereMitkolonialenGruessen2013.pdf (glokal.org)
S
In diesem Modul werden die Begriffe Schwarz oder People of Color (PoC) genutzt, Schwarz wird dabei großgeschrieben. Dies ist orientiert an der Selbstbezeichnung Schwarzer Menschen und bezeichnet kein biologisches Merkmal. Es umfasst alle von Rassismus negativ betroffenen Menschen der Gesellschaft, auch
wenn dies nicht durch die Hautfarbe deutlich wird. Durch diese Selbstbezeichnungen wird die Verbundenheit
gemeinsamer Rassismuserfahrungen deutlich gemacht. „Schwarzsein“ bedeutet, dass Menschen durch
gemeinsame Erfahrungen von Rassismus miteinander verbunden sind und auf eine bestimme Art und Weise
von der Gesellschaft wahrgenommen werden.
Dies ist die unbewusste oder bewusste Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Dabei gilt Männlichkeit als Norm, während man weibliche Menschen im System abwertet und klein hält. Hierfür bilden sozial geteilte Geschlechtertheorien und Geschlechtervorurteile die Grundlage. Sie gehen von einem ungleichen sozialen Wert von männlichen und weiblichen Menschen aus. Grundlage ist die Vorstellung, dass Männer von Natur aus Frauen überlegen seien.
W
Der Begriff weiß wird in diesem Portal klein und kursiv geschrieben. Diese Schreibweise dient dazu die unmarkierte, aber privilegierte Position weißer Menschen in der Schriftsprache sichtbar zu machen. Hierbei geht es nicht um Schuldzuweisungen oder den Vorwurf rassistisch zu sein, sondern darum, dass weiße Menschen von Privilegien profitieren, die Schwarze Menschen nicht erfahren.
„Weiß ist in unserem konstruktivistischen Verständnis von Rassismus keine objektive Kennzeichnung eines äußeren Erscheinungsbildes, sondern die in einer rassistischen Gesellschaft als solche konstruierte privilegierte Positionierung. Weiße Personen sind in der deutschen Gesellschaft nie aufgrund dessen, dass sie als weiß wahrgenommen werden, systematisch und strukturell diskriminiert worden und können dies als kolonialistisch Privilegierte auch nicht. Durch die Privilegierung dieser Positionierung als Teil rassistischer Gesellschaftskonstruktionen werden zugleich und häufig implizit deprivilegierte Positionierungen geschaffen. Denn Personen mit gewissen Privilegien (in Bezug auf Rassismus weiße) kann es nur im Gegensatz zu Personen ohne diese Privilegien geben.“
Definition nach Adibeli Nduka- Agwu und Lann Hornscheidt
Die Soziologin Robin DiAngelo beschreibt mit diesem Begriff eine Abwehrreaktionen von weißen Personen, die mit Emotionen wie Schuld, Wut und Angst auf das angesprochene Weißsein reagieren. Dabei zielt die „weiße Zerbrechlichkeit“ darauf ab, Personen, die Rassismen benennen, einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.
Quelle: DiAngelo, Robin (2018): Weiße Fragilität: Warum es für Weiße so schwer ist, über Rassismus zu
sprechen.
Bei dem Phänomen Whataboutism handelt es sich um einen Abwehrmechanismus oder auch einer Manipulationstechnik bei ungewollter Kritik, wodurch verhindert wird, dass über wichtige Themen wie z.B. Rassismus gesprochen wird. Stattdessen wird der Fokus auf andere Dinge gerichtet: „und was ist mit…?